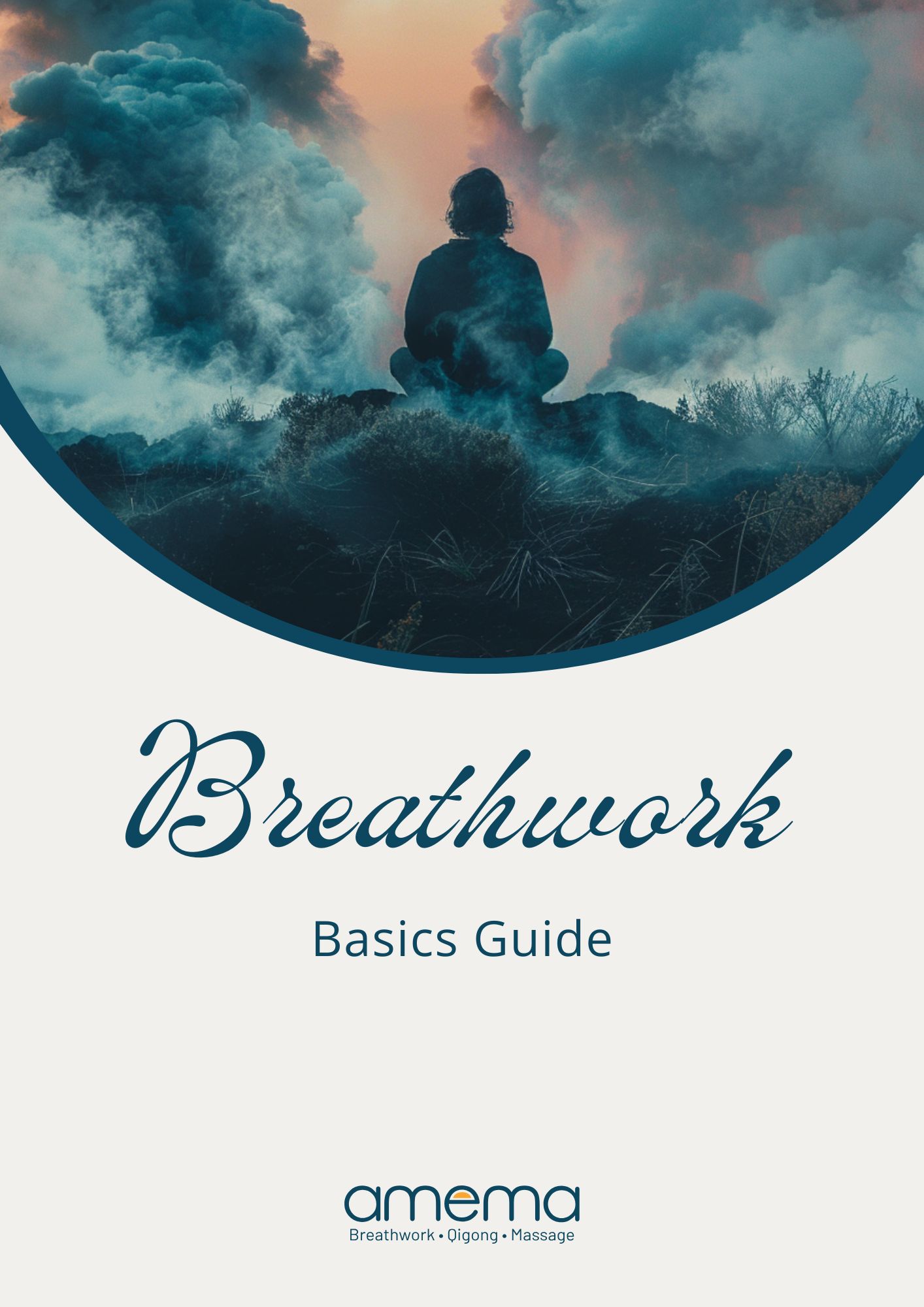Pranayama ist ein wesentliches Element des Yoga und bezeichnet die Praxis der Atemkontrolle. Der Begriff stammt aus dem Sanskrit, wo „Prana“ für die Lebenskraft oder Lebensenergie steht, die in allem Lebendigen vorhanden ist, und „Ayama“ für Ausdehnung, Kontrolle oder Zurückhaltung.
Die Praxis des Pranayama beinhaltet eine Reihe von Atemtechniken, die darauf ausgelegt sind, das Prana im Körper zu beeinflussen und zu regulieren. Durch bewusstes Atmen – das Kontrollieren von Einatmen, Anhalten des Atems und Ausatmen – wird Pranayamas Ziel verfolgt, den Geist zu beruhigen, körperliche und energetische Blockaden zu lösen und die mentale Konzentration zu verbessern.
Pranayama wird häufig als Vorbereitung für die Meditation verwendet, kann aber auch als eigenständige Praxis zur Verbesserung der Gesundheit und zur Steigerung des Wohlbefindens dienen. Regelmäßige Pranayama-Übungen sollen unter anderem das Nerven- und Immunsystem stärken, Stress reduzieren, den Blutdruck regulieren und unterstützend bei Angst- und Schlafstörungen wirken.
Es gibt verschiedene Pranayama-Techniken, wie zum Beispiel Ujjayi (der siegreiche Atem), Kapalabhati (der leuchtende Schädelatmung), Anulom Vilom (Wechselatmung) und viele mehr. Jede Technik hat spezifische Wirkungen und ist für unterschiedliche Zwecke geeignet. Wichtig ist, dass Pranayama unter fachkundiger Anleitung praktiziert wird, da eine unsachgemäße Ausführung zu unerwünschten Nebenwirkungen führen kann. Pranayama bildet neben den Körperhaltungen (Asanas) und der Meditation eine der drei Säulen des Yoga-Wegs.
Phasen
Es gibt in der Regel drei fundamentale Phasen, die den Atemzyklus strukturieren. Diese Phasen helfen dem Praktizierenden, den Atem zu steuern, um die physiologischen und energetischen Vorteile von Pranayama zu maximieren. Hier ist eine einführende Beschreibung dieser drei Phasen:
- Puraka (Einatmung): Diese Phase ist der Beginn eines jeden Atemzyklus und beinhaltet das bewusste und kontrollierte Einatmen von Luft durch die Nase. Die Einatmung sollte langsam und gleichmäßig erfolgen, um den Körper mit Sauerstoff anzureichern und das Prana (Lebensenergie) zu erhöhen. Viele Pranayama-Techniken betonen auf das vollständige Füllen der Lungen von unten nach oben, wobei zuerst der untere Teil der Lungen und zuletzt der obere Teil mit Luft voll wird.
- Kumbhaka (Atemverhalt): Nach dem Einatmen folgt eine Pause, bei der der Atem für eine bestimmte Dauer angehalten wird. Diese Atemretention kann intern nach der Einatmung (Antar Kumbhaka) oder extern nach der Ausatmung (Bahya Kumbhaka) erfolgen. Kumbhaka verlängert die Zeit, in der der Sauerstoff die Zellen des Körpers durchdringen kann und ermöglicht es auch, die Verteilung von Prana im Energiekörpersystem zu regulieren. Diese Phase ist besonders wirksam für die Vertiefung der Meditation und die Steigerung der Konzentration.
- Rechaka (Ausatmung): In der letzten Phase des Atemzyklus wird die Luft langsam und gleichmäßig durch die Nase ausgeatmet. Ziel ist es, die verbrauchte Luft und Toxine aus dem Körper auszustoßen. Ein längeres Ausatmen im Vergleich zur Einatmung kann entspannend wirken und den Parasympathikus stimulieren, der Teil des autonomen Nervensystems, der für Ruhe und Erholung zuständig ist.
Die genaue Ausführung und Dauer jeder Phase variiert je nach spezifischer Pranayama-Technik und sollte individuell angepasst werden. Zudem sollten Praktizierende stets auf ihren eigenen Körper und dessen Signale achten und Pranayama unter Anleitung eines erfahrenen Lehrers erlernen, um mögliche Risiken und falsche Anwendungen zu vermeiden.
Unabhängig von der gewählten Technik können diese drei Phasen des Atems als Werkzeuge betrachtet werden, die nicht nur die Atemfunktion verbessern, sondern auch dazu dienen, den Geist zu beruhigen und die spirituelle Entwicklung zu fördern.